Die nordischen Geschiebe des Muskauer Faltenbogen
Text: Frank Mädler, Cottbus, April 2009
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Allgemeines zu nordischen Geschieben
- Einleitung
- Ursprungsgebiet der nordischen Geschiebe
- Entstehung und Transport der nordischen
Geschiebe
- Klassifikation der nordischen Geschiebe
- Größe, Form und Volumen der nordischen
Geschiebe
- Geologische Besonderheiten an nordischen
Geschieben
- Die größten nordischen Geschiebe südlich
der Ostsee
- Sagen, Geschichten und
kulturgeschichtliche Aspekte von nordischen Geschieben
Teil 2: Die nordischen Geschiebe des Muskauer
Faltenbogen (Arbeiten noch nicht abgeschlossen)
- Verfahrensweise und Probleme zur
Kartierung der nordischen Geschiebe
- Vorkommen, Größe und Volumen der
nordischen Geschiebe
- Geologisch bemerkenswerte nordische
Geschiebe
- Sagen über nordische Geschiebe
- Nordische Geschiebe als Gedenksteine
- Verschollene und zerstörte
bemerkenswerte nordische Geschiebe
Anhang: Die nordischen Geschiebe des Muskauer
Faltenbogen
Erklärungen der
geologischen Fachausdrücke
Weiterführende Literatur
Literaturverzeichnis
Teil 1 Allgemeines zu nordischen
Geschieben
Einleitung
Zum geologischen
Erscheinungsbild des Muskauer Faltenbogen gehören neben den Giesern, Söllen,
Endmoränen und Faltungsstrukturen auch viele mehr oder weniger große Steine.
Allgemein hat sich der Begriff „Findlinge“
für diese Steine in den deutschen Sprachgebrauch eingebürgert. Ein
Findling ist im eigentlichen Wortsinn etwas Gefundenes, der Herkunft nicht
zuordenbares Objekt. So ist das auch bei den großen Steinen, die scheinbar
wahllos im Gelände zu finden sind. Ein anderer,
heute veralteter Begriff, welcher erstmals 1828 durch BRONGNIART
eingeführt wurde, lautet „erratische“ Blöcke aus dem Griechischen für
erratisch, gleich verirrt oder verstreut. Neben Findling und erratischer Block
ist auch der Begriff Geschiebe in der Literatur allgegenwärtig. J. C. D.
Schreber erwähnte bereits 1759 den Namen Geschiebe für Lesesteine. Alle drei
Begriffe treffen recht gut zu und zeigen, dass sich die Menschen schon lange mit
diesen Steinen beschäftigen. Dabei spielt vor allen die Frage ihrer Herkunft
und ihrer Entstehung eine dominierende Rolle. Schon 1774 erkannte der
preußische Hauptmann von Arenswald aus Neuenkirchen bei Anklam die nordische
Herkunft dieser Steine.
Damit sagte er aber
nicht aus, wie dieses Material so weit nach Süden kam. Als einzige
Möglichkeit galt damals ein gewaltiges Vordringen des Meeres nach Süden,
welches die Gesteine aus dem Norden nach Süden verfrachtete. In Anlehnung an
die biblische Geschichte wird sie als
Sintfluttheorie (L.VON BUCH 1815) bezeichnet. Als Beweis dienten die
zahlreichen auf dem Festland gefundenen
Meeresfossilien. Der Gutsbesitzer G. A. v. WINTERFELD (1738-1805) aus
dem Dorf Strieten bei Sternberg in Mecklenburg konnte sich jedoch nicht
vorstellen, dass solch große Steine, die er auf dem Gelände seines Gutes fand,
durch das Meer transportiert werden könnten. Daraufhin brachte als
Transportmedium der Steine schwimmende (driftende) Eisberge ins Gespräch, die dann beim Abtauen
die großen Steine verloren. CHARLES LYELL übernahm diese Theorie und dank
seiner Autorität als Geologe fand diese als Drifttheorie, die er in sein
Lehrbuch „Principles of Geology“ (1830-33) aufnahm, weltweite Anerkennung.
Seiner Zeit voraus und von den damals renommierten Geologen nicht beachtet,
äußerte sich bereits 1832 BERNHARDI mit den Worten „...dass also jene
nordischen Geschiebe verglichen werden müssen mit den Wällen von
Felsbruchstücken, die fast jeden Gletscher in bald größerer, bald geringerer Entfernung
umgaben, oder mit anderen Worten, nichts anderes sind, als die Moränen, welches
jenes ungeheure Eismeer bei seinem allmählichen Zurück-ziehen hinterließ“. Ein Jahr später, also 1833, kartierte PUSCH die Südgrenze der Blockbestreuung der
Erdoberfläche mit nordischen Material von der Ostküste Englands über den
Teutoburger Wald, das Erzgebirge bis nach Russland. Neben BERNHARDI bekamen
auch skandinavische Geologen bald Zweifel an der gültigen Drifttheorie Lyells.
Bei der geologischen Landeskartierung Schwedens fand der Geologe N.F.SEFSTRÖM
(1836) mehrfach Schrammen und Furchen auf den rundgeschliffenen Felshöckern,
die alle in NNW – SSE - Richtung wiesen. Außerdem hatte er davon gehört, dass
ähnliche Schrammen auf einem Muschelkalkfelsen in Rüdersdorf bei Berlin zu
finden seien. Der Direktor der schwedischen geologischen Landesuntersuchung
O.TORRELL konnte gemeinsam mit dem Norweger T.KJERULF aufgrund der in den Alpen
aufgestellten Gletschertheorie diese Schrammen als Gletscherschrammen deuten.
Als O.TORELL im November 1875 eine geologische Tagung in Berlin besuchte,
erinnerte er sich an den Hinweis von
N.F.SEFSTRÖM aus 1836 und besuchte die Rüdersdorfer Kalkberge. Er
erkannte diese Schrammen als Gletscherschrammen. Noch am gleichen Tag
postulierte er, Mitteleuropa sei nicht von schwimmenden Eisbergen, sondern von
kompaktem Inlandeis bedeckt gewesen. Man kann diese Erkenntnis, ähnlich wie die
Publizierung der Drifttheorie durch LYELL, nicht alleinig TORREL zuschreiben.
Neben ESMARK 1824, SEFSTRÖM 1836 und FORCHHAMMER 1843 wurden auch durch NAUMANN
und VON COTTA 1844 gemeinsam mit dem
Schweizer A. V. MORLOT bei Leipzig (Hohburger Berge) Gletscherschrammen
nachgewiesen. TORRELL gab dieser Erkenntnis auf Grund seiner Bekanntheit nur
das rechte Gewicht. Diese Meinung wurde
von den norddeutschen Geologen zunächst nicht akzeptiert. Erst als kurz darauf
am Choriner Endmöränenzug bei Eberswalde die glaziale Serie nachge-wiesen
wurde, lenkten diese ein und die Inlandeistheorie wurde als gültig anerkannt.
Neben der Problematik des Transportes der Geschiebe von Skandinavien nach Süden
wurden erste Gedanken zur Herkunft der Geschiebe Mitte des 19. Jahr-hundert
formuliert. Bereits 1848 stellte der Pinneberger Geologe und
Bergbau-unternehmer L. MEYN Übereinstimmung von Porphyren und Mandelsteinen aus
den Moränen und dem Oslogebiet fest. Er schrieb, dass die Geschiebe „ihre
Mutterkluft im skandinavischen Berggrund“ haben. Er war damit der erste der die
wahre Heimat der Geschiebe erkannte. 1856 sprach HAMPUS VON POST in einer
Beschreibung der Alandgranite von Findlingen. Diese Idee verfolgte G.DE GEER
1881 weiter, indem er mit Hilfe der Alandgranite einen „Baltischen Eisstrom“
rekonstruierte. Kurz danach im Jahre 1884 prägte DE GEER den Begriff „
ledeblock“. Die beiden Greifswalder Geologen COHEN und DEEKE publizierten 1891
umfangreiche Vergleiche von nordischen Geschieben aus Vorpommern und dem
skandinavischen Raum. Der dänische Geologe V.MITLTHERS baute diesen Begriff
1909/1913 aus. Das „Leitgeschiebe“ war geboren. In der Folgezeit rückten die
nordischen Geschiebe immer mehr in das Visier der Geologen. Zahlreiche
Publikationen speziell vor allen für den norddeutschen Raum wurden dazu
veröffentlicht. Erste Auflistungen und Bestimmungsbücher erschienen.
Dabei wurde südbrandenburgisch-nordsächsische
Raum stiefmütterlich behandelt. Nur wenige, meist auf Einzelobjekte bezogene
Ausarbeitungen erschienen. Im Bereich des Muskauer Faltenbogen gibt es
lediglich sporadische Hinweise auf nordische Geschiebe in den Erläuterungen der
geologischen Spezialkartierung Anfang des 20. Jahrhundert. Am Rande der 3.
Geoparktagung Muskauer Falten-bogen 2004 in Rietschen wurde der Entschluß
gefasst, eine Kartierung der nordischen Geschiebe im Muskauer Faltenbogen auf
deutscher und polnischer Seite vorzunehmen.
Ursprungsgebiet der nordischen Geschiebe (Abb.1)
Die Bezeichnung
„nordisches Geschiebe“ weist bereits auf den Ursprung der Ge-steine auf das
nördliche Europa wie Skandinavien, den Ostseeraum, Finnland, Dänemark und das
Baltikum hin. Zahlreiche Gesteinsarten sind aus dem Norden Europas bekannt.
Viele davon kann man als nordische Geschiebe auch im Muskauer Faltenbogen
finden. Die Vielfalt der Gesteine weist auf komplizierte geologische
Verhältnisse in Skandinavien hin. Das gesamte nördliche Europa ist altes
Festland. Ganz grob kann man geologisch Norwegen, Schweden, den Ostseeraum,
Finnland und das Baltikum in vier geologische Zeitkomplexe einteilen.
|
Geologische Zeitkomplexe der
Entstehung nordischer Geschiebe |
||
|
Zeitkomplex |
Alter |
Typische
Geschiebe |
|
Präkambrisches
Grundgebirge |
>3,0
– 0,545 Mrd. Jahre Erdurzeit |
Granite
von Stockholm, Uppsala, Ålandinsel,
Bornholm; Porphyre
von Schweden, Ålandinseln; jotnischer (Dala) Sandstein |
|
|
Erdaltertum - Erdneuzeit |
|
|
Kaledonische
Gebirgsbildung |
400
Mill. Jahre |
bisher
begründet in der schweren Erkenntlichkeit noch nicht in Mitteleuropa
nachgewiesen |
|
Paläozoisch,
mesozoische, känozoische Gesteine |
545 –
1,8 Mill. Jahre |
Kinne-Diabas,
Schonen-Basalt, Orthocerenkalk,
Paläoporellenkalk, Kreide, Feuerstein |
|
Oslograben |
296 –
251 Mill. Jahre |
Rhombenporphyr,
Larvikit |
Der größte Teil der kristallinen nordischen
Geschiebe im Muskauer Faltenbogen hat seine Ausgangsgesteine im ersten Zeitkomplex, dem präkambrischen
Grundgebirge. Es erstreckt sich etwa von der heutigen norwegisch-schwedischen
Grenze über die Ostsee bis nach Finnland.
Derzeit unterscheiden die Geologen mehrere
Gebirgsbildungsphasen (Zyklen) im Grundgebirge. Der älteste Zyklus in
Nordfinnland und der Umgebung des Weißen Meeres wird als saamidischer Zyklus
mit einem Alter von 2,5 – 3,2 Mrd. Jahren bezeichnet. Geschiebe aus diesem Raum
wurden bisher im Muskauer Faltenbogen nicht nachgewiesen.
Der nachfolgende belomoridische Zyklus, ca.
2,7 - 2,8 Mrd. Jahre alt, ist über-wiegend durch Gneise geprägt. Geschiebe sind
diesem Zyklus nur durch Spezial-untersuchungen zuzuordnen.
Weit häufiger und auch eindeutiger bestimmbar
sind die Geschiebe, die dem svekofennisch - karelischen Zyklus (Svekofenniden
und Kareliden ) vor 1,65 - 2 Mrd. und dem Transskandinavischen Magmatitgürtel
(TIB), der die Svekofenniden im Südwesten begrenzt, zuzuordnen sind. Dazu
gehören zum Beispiel die Granite von
Uppsala, Stockholm, Revsund u.a. von Schweden sowie die Granite von Perniö aus
Finnland. Nicht zu vergessen sind die Småland - Porphyre/ Ignimbrite als häufige
nordische Geschiebe. Daneben treten
Migmatite, Gneise und Gneisgranite auf, die jedoch schwer zu bestimmen bzw.
einer bestimmten Gegend zuzuordnen sind. Die jüngsten Gesteine aus dem TIB sind
die spätorogen Dalagranite (Siljangranit, Garberggranit) und zahlreiche
Porphyre und Ignimbrite. Etwas jünger 1,47-1,58 Mrd. Jahre sind die
Rapakivigesteine der Alandinseln, der Umgebung von Rodö und Ragunda in
Mittelschweden sowie von SW-Finnland (Nystad).
Der nächst folgende ist der dano-polonische
Zyklus mit einem Alter von ca. 1,45 Mrd. Jahren. Aus dieser
Gebirgsbildungsphase und der spätorogenen Nachphase stammen die häufig in
Brandenburg zu findenden Bornholm-Granite und der Karlshamn – Granit. Der
jüngste Gebirgsbildungszyklus mit einem Alter von
ca.1,0 Mrd. Jahren ist der im SW Schwedens und
Norwegens gelegene sveko – norwegische Zyklus. In dieser Faltungsphase treten
wiederum eine Vielfalt von Gneisen und hochmetamorphe Gesteine, wie
Granatcoronite auf. Der Granit von Bohuslän ist ebenfalls in diesen Zyklus
einzuordnen.
|
Gebirgsbildungszyklen des
Grundgebirges des nördlichen Europas |
|||
|
|
Alter in
Jahren |
Verbreitung |
wichtige
Gesteine |
|
saamidischer
Zyklus |
2,5-3,2
Mrd. |
Nordfinnland, Umgebung
Weißes Meer |
Gneise |
|
belomoridischer
Zyklus |
2,7 –
2,8 Mrd. |
Nordostfinnland |
Gneise |
|
svekofennisch
– karelischer Zyklus mit Transskandinavischen Magmatitgürtel |
1,65 –
2,0 Mrd. |
Schweden,
Finnland Ålandinseln |
Gneise, Granite Porphyre |
|
Rapakivi
Zyklus |
1,47
–1,58 Mrd. |
Schweden
(Rödö,Ragunda) SW-Finnland (Nystad,Vehmaa) Ålandinseln |
Granite,Porphyre |
|
dano-polonischer Zyklus |
1,4 –
1,5 Mrd. |
Südschweden,
Born- holm |
Granite, Diabase, Gneise |
|
sveko-norwegischer
Zyklus |
1,0 Mrd |
Südwestschweden,
Südnorwegen |
Gneise,
Granatcoronite |
Im jüngsten
Präkambrium, dem Jotnium (1,3 – 0,545 Mrd. Jahre), fand in Mittel-schweden und
im Ostseeraum eine intensive großräumige Abtragung statt. Es bildeten sich die
jotnischen, auch Dala - Sandsteine genannt. Ebenfalls sind aus dieser Zeit auch
Diabase bekannt.
Im westlichen Teil
(siehe Abb.1) wird der Untergrund durch den zweiten Zeitkomplex, das heute
stark abgetragene Faltengebirge der kaledonischen Gebirgsbildung vor 400 Mill.
Jahren, geprägt. Geschiebe aus dieser
Gebirgsbildung treten in Mittel-europa resultierend aus den Gletscherbewegungen
der Eiszeit nur vereinzelt auf und sind schwer nachweisbar.
Beim Wechsel der
Erdurzeit zum Erdaltertum kam es zur Einsenkung der Ostsee-depression. Es
entstanden überwiegend Sedimentgesteine des dritten Zeitkom-plexes. Von
Südschweden über den Ostseeraum bis in das Baltikum wurden die Gesteine des
Grundgebirges durch fossilreiche Schelf- und Flachmeersedimente, vor allem
Kalk- und Sandsteine sowie Schiefer vom Kambrium bis zum Perm überlagert. Dazu
gehören die bei Fossiliensammlern beliebten Paläoporellenkalke,
Orthoceren-kalke, Ostseekalke, Backsteinkalke und andere. An geologischen
Störungszonen drangen vielerorts Diabase auf, die Sedimente überdeckten. Durch
spätere Erosion wurden vorallen die Kalke und Sandsteine begründet in ihrer
Härte und Anfälligkeit gegenüber witterungsbedingten Einflüssen abgetragen.
Dort, wo sie von den härteren Diabasen überdeckt wurden, blieben so genannte
Schichtstufenberge erhalten, z.B. der Kinnekulle in Västergötland. In den
südlichen Teil der Ostsee drang im Mesozoikum (Trias, Jura, Kreide) und
Känozoikum (Tertiär) das Meer vor und lagerte mächtige Sedimente ab.
Sedimentgeschiebe aus dieser Zeit sind im Mus-kauer
Faltenbogen, außer Feuersteinen und silifizierten Kalken, recht selten,
jedoch an der Ostseeküste und Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern
recht häufig. Als kristallines Gestein aus diesem Zeitkomplex ist der
Schonen-Basalt aus dem Jura auch im Muskauer Faltenbogen zu finden.
Der vierte
Zeitkomplex, aus dem nordische Geschiebe allerdings nur gelegentlich hier in
unseren Raum gefunden werden, ist der Bereich um Oslo. Dieses Gebiet ist eine
geologische Besonderheit in Europa. Es ist das Nordende einer tektonischen
Grabenzone, die sich von der Rhonemündung über den Oberrheintalgraben, das Mainzer
Becken, den Leinegraben, Schleswig-Holstein, Kattegat nach Oslo erstreckt, die
sogenannte Mittelmeer-Mjösen-Zone. Im Altpaläozoikum wurde diese Grabenzone
angelegt. Kambrische und silurische Sedimente konnten im Untergrund durch
Bohrungen nachgewiesen werden. Die Absenkung setzte sich vor allem im Karbon
und Perm fort. In dieser Zeit intrudierten zahlreiche alkalireiche Magmen im
Osloraum und kompensierten die Depression. Eine große Vielfalt an
petrographisch außergewöhnlichen Gesteinen wie Larvikit, Rhombenporphyre und
andere, die wir heute als Geschiebe vor allem in Norddeutschland aber auch sehr
selten im Mus-kauer Faltenbogen finden, entstanden.
Abb. 1 Schematisch ohne Maßstab
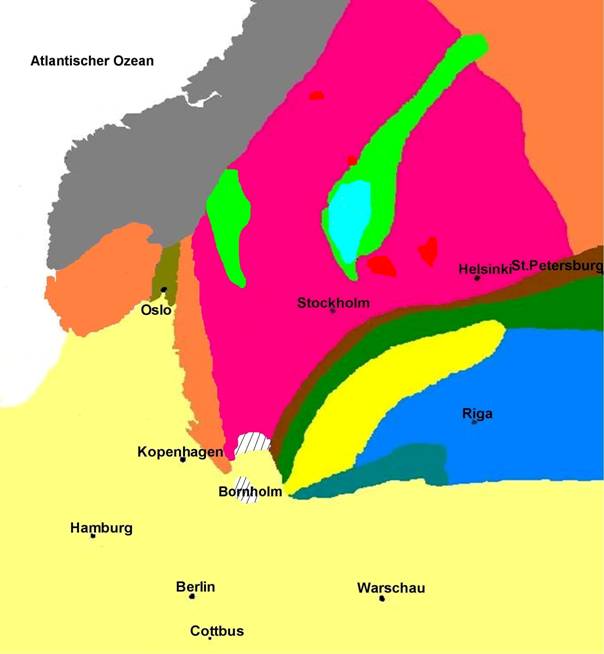
![]()
![]()
![]()
unter
Verwendung Smed/Ehlers 1994; Schulz 2003; Gläßer et.al. 2003; Scholz&Obst
2004; Bräunlich 2004
![]()
![]() Kreide/Tertiär
142 – 1,8 Mill. Jahre Kaledoniden 410 – 400 Mill. Jahre
Kreide/Tertiär
142 – 1,8 Mill. Jahre Kaledoniden 410 – 400 Mill. Jahre
![]()
![]() Perm 296 - 251 Mill. Jahre
Svekonorwegiden 1000 Mill. Jahre
Perm 296 - 251 Mill. Jahre
Svekonorwegiden 1000 Mill. Jahre
![]()
![]()
Devon 417 – 358 Mill. Jahre Jotnium 1300 – 545 Mill. Jahre
![]()
![]()
Silur 443 – 417 Mill. Jahre Danopoloniden 1400 – 1500
Mill. Jahre
![]()
![]() Ordovizium 495 – 443 Mill. Jahre Rapakivigesteine 1470 – 1580
Mill.Jahre
Ordovizium 495 – 443 Mill. Jahre Rapakivigesteine 1470 – 1580
Mill.Jahre
![]()
![]() Kambrium 545 –
495 Mill. Jahre Svekofenniden
mit TIB 1500 – 2000 Mill. Jahre
Kambrium 545 –
495 Mill. Jahre Svekofenniden
mit TIB 1500 – 2000 Mill. Jahre
![]()
![]() Kambrosilur 545 – 410 Mill. Jahre Kareliden
älter 1800 Mill. Jahre
Kambrosilur 545 – 410 Mill. Jahre Kareliden
älter 1800 Mill. Jahre
![]()
Karbon - Jura
358 – 200 Mill. Jahre ohne
Quartärbedeckung
Entstehung und
Transport nordischer Geschiebe
Entstanden sind die nordischen Geschiebe durch
Gletscherschurf (Exaration) an der Eisbasis, vor dem Eis und an den Eisfronten
sowie durch Erosionsvorgänge im Zusammenhang mit Schmelzwässern des Inlandeises
im nördlichen Europa. Im Frühpleistozän kam es zu Abkühlung der Atmossphäre.
Auf den höchsten Erhe-bungen Skandinaviens, den Kaledoniden bildeten sich
mächtige Gletscher, die dann nach Süden, Südosten und Südwesten aber auch nach
Westen und Nordwesten vordrangen. Die sogenannte Eisscheide befand sich etwa
auf der heutigen schwedisch - norwegischen Grenze. Dort lag auch das Nährgebiet
des Gletschers. Es wird eingeschätzt, dass die Mächtigkeit des Eises dort um
2000 bis 3000 m lag. Das Eis floss aufgrund des Eigengewichtes von der höchsten
Stelle (der Eisscheide) beidseitig ab. Die Eisbewegung erfolgt vorwiegend durch
plastisches Fließen und nur untergeordnet in Form basalen Gleitens über den
Untergrund. Dabei spielen vor allem Eismächtigkeit und Eistemperatur für die
Auslösung, Steuerung und Geschwin-digkeit der Gletscherbewegung eine
entscheidende Rolle. Die durchschnittliche Vordringgeschwindigkeit der
Gletscher wird von Eissmann
(1987) mit wenigstens 70 m pro Jahr für das Weichsel-Eis und etwa 140-250 m im
Jahr für das Elster- und Saale - Eis angegeben. Die Mächtigkeit (Höhe) der
Gletscher im Brandenburg wird noch auf 300 bis 500 m eingeschätzt. Durch das
Vordringen des Gletschers werden Gesteine aus dem Untergrund aufgenommen in das
Gletschereis eingearbeitet und transportiert. Skandinavische Morphologen haben
errechnet, daß vom skandina-vischen Festland ca. 25 m und vom Boden der Ostsee
ca. 60 m abgetragen wurden. Die aufgenommenen Geschiebe regeln sich bei ihrer
Ablagerung mit ihrer Längs-achse
parallel zur Fließrichtung des Eises ein. Daraus können die Geologen
Rück-schlüsse auf die Fließrichtung des Eises ziehen. Mit Abnahme der
Eismächtigkeit und damit verbundenen Änderung der eismechanischen Bedingungen
im Gletscher sinken die Geschiebe auf den Untergrund ab. Mit dem Vordringen
nach Süden nimmt die Transportkraft der Gletscher ab. Dabei lösen sich die
größeren Findlinge zuerst, d.h. im Norden, ab. Nachdem die Geschiebe auf den
Untergrund abgesunken sind, werden sie vermutlich noch auf eine längere Distanz
„mitgeschleift“. Die größeren Geschiebe werden kantengerundet, die kleineren
„abgerollt“. Dabei spielen Schmelzwässer unter dem Gletscher eine nicht
unerhebliche Rolle. Durch die Bewegung der Geschiebe auf dem Untergrund sind
auch die sogenannten Gletscherschrammen (strichförmige Einritzungen auf
Geschieben durch Reibungen der Geschiebe untereinander) erklärbar. Die Größe
und der Transportweg der Geschiebe hängt von der Struktur, dem Kluftabstand,
der Festigkeit und dem Zu-stand der Verwitterung der Ursprungsgesteine ab.
Kluftreiche (Porphyre), relativ weiche bzw. stark geschichtete Gesteine( z.B. Beyrichienkalke,Sandsteine
etc.) erreichen selten Größen über 1,0 m Durchmesser. Resultierend daraus
erreichten die meisten mesozoischen und tertiären sowie einige paläozoische
Sedimente nicht den Südbrandenburger Raum. Eine Ausnahme der tertiären Gesteine
bilden dabei die kristallinen Gesteine (Basalte und Diabase) und Feuersteine
bzw. silifizierte Kalke.
Durch die Lage der Eisscheide an der Grenze
des Kaledonischen Gebirges mit dem Grundgebirge läßt sich erklären, warum durch
die Eiszeiten nur wenige schwer identifizierbare norwegische Gesteine (außer
Oslogebiet) in das nördliche Mittel-europa transportiert wurden.
Klassifikation
der Geschiebe
Nordische Geschiebe
als wichtige Objekte für petrographische und paläontologische Studien sowie zur
Klärung von glazialen Vorgängen, wurden schon frühzeitig mit ver-schiedenen
Bezeichnungen benannt, um die Klassifizierung der aufgefundenen Ge-schiebe zu
erleichtern bzw. sie entsprechend der Forschungszielstellung einzu-ordnen. Die
Haupteinteilungskriterien sind Größe, Zusammensetzung und Herkunft.
SPEETZEN (1998)
teilte die Geschiebe nach Größe folgendermaßen ein:
|
Geschiebebezeichnung |
Länge |
Volumen (m³) |
Gewicht (t) |
|
Riesengeschiebe |
>10 m |
>200 |
>500 |
|
Großgeschiebe |
2 - 10 m |
2 - 200 |
5 - 500 |
|
Grobgeschiebe |
0,2 - 2 m |
0,002 - 2 |
0,005 - 5 |
|
Kleingeschiebe |
2 - 20 cm |
<0,002 |
<0,005 |
|
Feingeschiebe |
2 - 20 mm |
|
|
Die Großgeschiebe
werden auch als Findlinge bezeichnet. Diese wurden nochmals in Klassen
unterteilt:
|
Klasse |
Volumen (m³) |
Gewicht (t) |
|
1 |
2 - 5 |
5 - 10 |
|
2 |
5 - 10 |
10 - 20 |
|
3 |
10 - 20 |
20 - 50 |
|
4 |
20 - 50 |
50 - 100 |
|
5 |
50 - 200 |
100 - 500 |
.
Einteilung nach
Zusammensetzung
Wichtig für die
Zuordnung der Grundmoränen ist die petrographische Geschiebe-analyse. Sie
bildet das grundlegende Kriterium der Zuordnung der Grundmoränen in die
jeweilige Eiszeit. Dabei wird die Zusammensetzung der Geschiebefamilie
ermittelt. Unter Zusammensetzung wird hier die petrographische Einordnung
verstanden, in der die Geschiebe ihren Ursprung haben. Es werden zwei große
Gruppen unterschieden. Zum einen die Gruppe der Kristallinen Gesteine. Dazu
gehören die Plutonite (Granite, Diorite, Syenite, Gabbros), die Vulkanite
(Porphyre, Porphyrite, Basalt, Diabase, Ignimbrite, Tuffe) und die Metamorphite
(Gneise Hornfelse, Marmor). Die zweite Gruppe umfaßt die Sedimentgesteine
(Sandsteine, Kalksteine, Dolomite, Schiefer). Unter Großgeschieben ab Klasse 2
finden wir überwiegend, soweit es sich um Ferngeschiebe handelt, bedingt durch
die große Festigkeit kristalline Gesteine.
Einteilung nach der
Herkunft
Die Geschiebe wurden
aus dem nordeuropäischen Raum, aber auch aus den durch das Eis überfahrenen
Mittelgebirgen (z.B. Weserbergland) an den Ort ihrer Abla-gerung transportiert.
Daraus ergeben sich zwei Aspekte der Einteilung der Geschie-be nach ihrer
Herkunft. Zum einen nach der Transportentfernung und zum anderen nach dem
Ursprungsort. Nach der Transportentfernung werden die Geschiebe in
Ferngeschiebe, Nahgeschiebe und Lokalgeschiebe eingeteilt. Gesteine aus
Fenno-skandien, dem mittleren bis nördlichen Ostseeraum und dem Baltikum werden
den Ferngeschieben zugeordnet. Typische Gesteine für Nah- und Lokalgeschiebe zu
nennen, ist schon schwieriger. Die Bezeichnung hängt vom Ort des Auffindens des
Geschiebes ab. Ein Beispiel soll diesen Fakt veranschaulichen. Silifizierte
Kalke bzw. Feuersteine sind auf der Insel Rügen Lokalgeschiebe und in
Brandenburg Nahgeschiebe. Sandsteine als Großgeschiebe in Nordrhein-Westfalen
sind immer Lokalgeschiebe. Als weiterer Begriff wird in der Literatur der
Begriff südliches und nördliches Geschiebe genannt. Zu den südlichen Geschieben
werden die Geschiebe gezählt, die durch die Vereisungen der Alpen bzw.
Schwarzwald/Vogesen nach Süddeutschland transportiert wurden. Im Raum
Brandenburg sind südliche Geschiebe nicht aufzufinden. Die oft genannten
südlichen Geschiebe aus dem nordböhmischen Raum sind keine Geschiebe, sondern
Gerölle (Transport durch Flüsse!). Nordische Geschiebe sind solche, die durch
die nördlichen Vereisungen nach Süden bis zu Feuersteinlinie verlagert wurden.
Die für die
Geschiebeforschung wichtigste und auch bekannteste Bezeichnung von Geschieben
ist die Bezeichnung Leitgeschiebe. Leitgeschiebe sind solche Ge-schiebe, egal
ob Klein - oder Riesengeschiebe, welche eindeutig mit einfachen Mitteln
zuverlässig bestimmt werden können, leicht zu beschreiben und einem bestimmten
Herkunftsgebiet sicher zuzuordnen sind. Ist dieses bestimmte Herkunfts-gebiet
relativ kleinflächig, spricht man von absoluten Leitgeschieben. Gute Beispiele
dafür sind der Rhombenporphyr oder der Ålandrapakivi. Sicher bestimmbare Gesteine,
die ein flächenhaft großes, aber definiertes Areal einnehmen, z. B.
Ortho-cerenkalk, werden als statistisches Leitgeschiebe bezeichnet. Vor allem
für die lithostratigraphische Einordnung der Grundmoränen ist der Anteil der
paläozoischen Kalke, die überwiegend statistische Leitgeschiebe sind, von
großer Wichtigkeit.
Im Muskauer Faltenbogen findet man relativ
häufig sehr gut bestimmbare Gesteine, wie die Jotnischen Sandsteine, die aber
weder absolute noch statistische Leit-geschiebe sind. Ihr Vorkommen liegt zum
einen in Schweden (Dalarna), aber auch sind sie sicher aus der nördlichen
Ostsee (Bottenmeer) bekannt. Eine Zuordnung zum Herkunftsort kann nur erfolgen,
wenn die Geschiebesippe - eine
Geschiebe-sippe bildet eine Gruppe von Leitgeschieben - bekannt ist, d.h. wenn sichere Leitgeschiebe
in recht großer Anzahl mit dem Jotnischen Sandstein zusammen vorkommen. So
weisen u.a. Särnaporphyre, Siljangranit, Garberggranit und weitere
Leitgeschiebe aus Dalarna auf die Herkunft der Jotnischen Sandsteine auf
Dalarna hin. Bottenmeerporphyre hingegen zeigen als Herkunft des Jotnischen
Sandsteines den nördlichen Ostseeraum an.
Durch verschiedene Autoren werden unterschied-liche Geschiebesippen im
nordeuropäischen Vereisungsgebiet genannt.
Die Verbreitung der
wichtigsten, auch im Muskauer Faltenbogen zu findenden Leitgeschiebe zeigt Abb. 2.
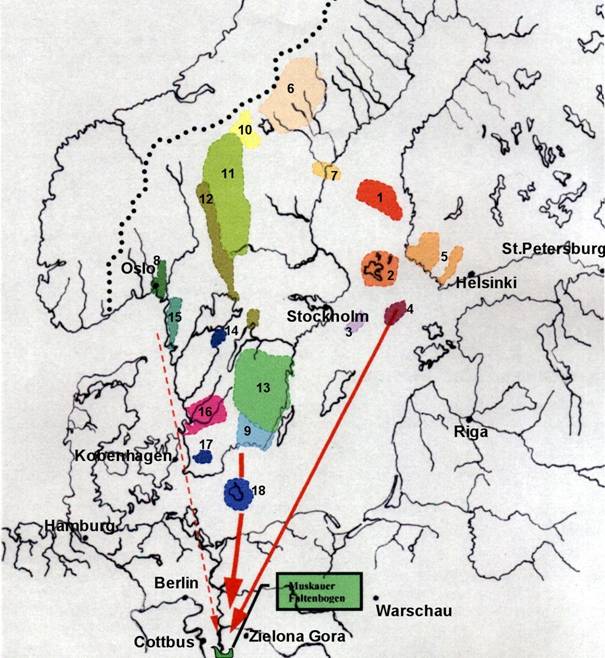
Abbildung
2 nach Koch 1927; Hesemann 1975;
Smed&Ehlers 1994; Bräunlich 2004;Schulz 2003
![]()
![]() Bottenmeergesteine
(Porphyr, Gneis) (1) Rätangranit
(10)
Bottenmeergesteine
(Porphyr, Gneis) (1) Rätangranit
(10)
![]()
![]() Ålandgesteine
(Granite, Porphyr) (2) Dalagesteine
(Granit, Porphyr, Diabas ) (11)
Ålandgesteine
(Granite, Porphyr) (2) Dalagesteine
(Granit, Porphyr, Diabas ) (11)
![]()
![]()
Brauner Ostseequarzporphyr (3) Filipstadgranit
(12)
![]()
![]() Roter Ostseequarzporphyr (4) Smålandgestein (Granit, Porphyr, u.a.) (13)
Roter Ostseequarzporphyr (4) Smålandgestein (Granit, Porphyr, u.a.) (13)
![]()
![]()
SW-finnische Gesteine (Granit, Porphyr) (5) Kinnediabas
(14)
![]()
![]() Ragunda
- und Revsundgranit (6) Bohuslängranit
(15)
Ragunda
- und Revsundgranit (6) Bohuslängranit
(15)
![]()
![]()
Rödögesteine (Granit, Porphyr) (7) Granatamphibolit (16)
![]()
![]()
Oslogesteine (Larvikit,
Rhombenporphyr u.a.) (8) Schonenbasalt
(17)
![]()
![]()
Karlshamn- und
Spinkamalagranit (9) Bornholmgranite
(18)
![]() Eisscheide
Eisscheide
Geologische
Besonderheiten an nordischen Geschieben
Betrachtet man die
nordischen Geschiebe näher, so stellt man oft auffällige Formen oder Schrammen
fest. Am häufigsten sind dabei eigentümliche Schrammen. Diese entstehen, wenn
harte, spitzkantige Geschiebe durch das Eis über weiche Gesteine geschoben
werden. Diese Schrammen werden als Gletscherschrammen bezeichnet. Sie treten
zum einen im Untergrund (z.B. bei Rüdersdorf), zum anderen aber auch auf den
Geschieben selbst auf. Selbst bei relativ kleinen Geschieben findet man diese
Hinweise auf glaziale Entstehung (Abb. 3).
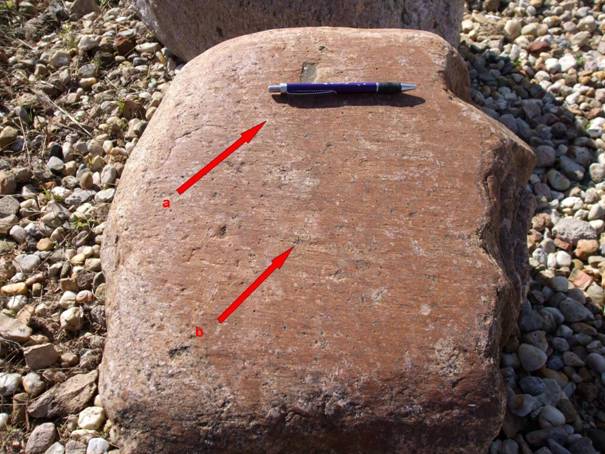
Abb. 3
Gletscherschrammen (a) und Parabelrisse (b) auf einem Granitgeschiebe im
Findlingspark
Seddiner See
Drehen sich diese
Geschiebe beim Transport, so werden dann in verschiedenen Richtungen Facetten
geschliffen und es entstehen Eiskanter. Ebenfalls durch Druck entstehen bei
Überschreiten der Scherfestigkeit des beanspruchten Gesteins quer dazu zu den
Gletscherschrammen Parabelrisse, die dann bei noch höherer Beanspruchung
sichelförmig ausbrechen. Diese Bildungen werden als Sichelbrüche bezeichnet.
Nachdem die Eiskappe in Mitteleuropa abgetaut
war, prägten polare Wüsten das Landschaftsbild im nördlichen Mitteleuropa.
Starke Sandstürme schliffen die nun freiliegenden Geschiebe ähnlich einem
Sandstrahlgebläse ab. Durch unterschied-liche
Windrichtungen wurden die Geschiebe aus verschiedenen Richtungen
ab-geschliffen. Dabei wurden sie regelrecht facettiert. Es entstanden die Windkanter
(Abb. 4). Die Größe der Geschiebe spielt dabei keine Rolle.
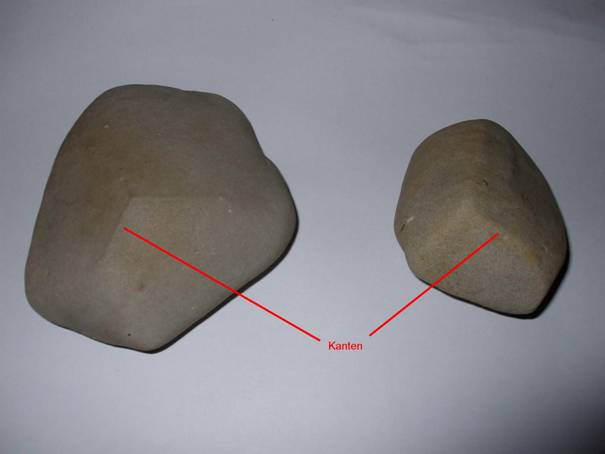
Abb. 4
Eine weitere an
Geschieben selten zu findende Besonderheit ist die Wollsack-verwitterung. Es
ist eine besondere Form der Verwitterung, die überwiegend bei Graniten
auftritt. Das Geschiebe hat die Form von aufeinandergestapelten Wollsäcken.
Dieses Aussehen verdanken die Granite der Klüftung des Gesteins. Durch
Eindringen von Wasser in die Klüfte setzt dort die Verwitterung des Gesteins
intensiver ein als im ungeklüfteten Bereich. Die Bestandteile des Granites beson-ders die Feldspäte und der Glimmer,
werden zersetzt, vergrusen und platzen schalenförmig ab. Die Folge davon sind
abgerundete Kanten und es bilden sich diese wollsackähnlichen Form heraus (Abb.
5).

Abb. 5
Findling in einer auflässigen Kiesgrube bei Reuthen im Muskauer Faltenbogen
Von hohem
wissenschaftlichen Wert ist der Fossilgehalt der Sedimentärgeschiebe. Ab
Kambrium wurden diese Lebensspuren in nordischen Geschieben nachgewiesen.
Einige Fossilien sind bisher nur in nordischen Geschieben nachgewiesen worden.
Das wohl berühmteste dabei ist das
„Xenusion auerswaldae“ aus dem Kalmar-sundsandstein, das in das Unterkambrium
eingestuft wird und damit zu den ältesten Lebensspuren zählt. Dieses Fossil ist
bisher im Anstehenden in Schweden noch nicht nachgewiesen sondern nur in
nordischen Geschieben gefunden worden und zeigt damit, welche Bedeutung die
Geschiebeforschung für die geologischen Wissenschaften besitzt.
Oft enthalten nordische Geschiebe auch Spuren
von den verschiedensten Erzen.
Vor allen kann man
Pyrit, Kupferkies und verschiedene Eisenerze finden. Selbst Goldnuggets wurden
aus glazialen Sedimenten (Sanden und Kiesen) in Schleswig- Holstein gewaschen.
Durch die Kartierung von kupfererzführenden Geschieben wurde im Jahre 1910 die
Kupferlagerstätte Outokumpu in Finnland entdeckt.
All diese Beispiele
zeigen die immense Bedeutung der Geschiebeforschung für die geologischen
Wissenschaften.
Die größten
Findlinge südlich der Ostsee
Die Transportkraft
des Eises ist nicht unerheblich. Um dies zu verdeutlichen, seien hier einige
der größten Geschiebe genannt. Die wahrscheinlich größten Geschiebe des
nordeuropäischen Vereisungsgebietes finden wir im Baltikum. Nahe der estnischen
Haupstadt Tallin liegt ein finnischer Pegmatit mit einem Volumen von 930 m³
(2450 t). Die Transportentfernung beträgt ca. 150 km. Weiter südlich in Tychowo
in Nordwestpolen befindet sich der vermutlich größte Findling südlich der
Ostsee. Er wird als Triglaffstein bezeichnet und hat eine Größe von 760 m³
(1980 t). Dieser Findling ist nicht eindeutig einem Herkunftsort zuzuordnen. Er
wurde als Gneis mit Granaten bestimmt und ist damit kein absolutes
Leitgeschiebe. Eindeutig zuordenbar sind dagegen der Große und der Kleine
Markgrafenstein in den Rauenschen Bergen bei Fürstenwalde. Diese Findlinge
haben immerhin noch ein Gewicht von 750 bzw. 240 t. Sie wurden beide als
Karlshamn-Granit bestimmt und stammen aus Süd-schweden. Sie haben damit einen
Transportweg von 450 km hinter sich. In Nord-rhein-Westfalen befindet sich bei
Rahden der Große Stein von Tonnenheide. Dieser Findling, ein Uppsala-Granit mit
einer Größe von 100 m³ und 270 t hat eine Trans-portentfernung von ca.1000 km
vom Anstehenden bis zum Ablagerungsort. Selbst im südbrandenburger Raum in
Kobbeln bei Eisenhüttenstadt kann man den Kobbelner Stein mit 90 m³ und einem
Gewicht von 240 t besichtigen. Es handelt sich um einen Bornholm Gneisgranit.
Die Transportentfernung beträgt ca. 400 km. Ein bemer-kenswerter Findling im
Muskauer Faltenbogen ist der Teufelsstein im polnischen Kamenica bei Trziebel.
Es handelt sich bei diesem Findling um einen Växjö-Granit aus Småland in Schweden. Mit 32,5m³ und einem
Gewicht von ca. 101 Tonnen ist es das deutlich größte nordische Geschiebe im
Muskauer Faltenbogen und wahrscheinlich auch der südlichste Findling über 100
Tonnen Gewicht, den die nordische
Vereisung nach Mitteleuropa transportiert hat. Die Transportentfernung betrug
immerhin noch 600 km.
Sagen, Geschichten
und kulturgeschichtliche Aspekte von Findlingen
Die nordischen
Geschiebe spielen schon seit frühesten Zeiten eine große Rolle in der
Gedankenwelt der Menschen. Bekannt sind die im gesamten Norddeutschland
verbreiteten Hünen - oder Großsteingräber, welche mit erstaunlichem Aufwand aus
tonnenschweren Findlingen in vorgeschichtlicher Zeit hergestellt wurden.
Ebenfalls bereits in vorgeschichtlicher Zeit wurden Belemniten und andere
Fossilien als Grabbeigaben verwendet, wie Funde in Gräbern aus der Steinzeit
beweisen. Im Glauben unserer Vorfahren sollte dieser Grabschmuck wohl vor Bösem
bewahren. Einigen Urnengräbern aus der spätrömischen Zeit wurden Seeigel (aus
der Kreide von Dänemark und Rügen) beigelegt. Unklar ist, ob diese als Talisman
oder als Spielstein genutzt worden sind. Relativ sicher ist die Verwendung der
Seeigel als Spielsteine in der Wikingerstadt Haitabu oder auch in einer
Slawensiedlung bei Parchim, da diese dort in großer Anzahl bei Ausgrabungen
außerhalb der Gräber in Wohnbereichen gefunden worden sind.
Der im Volk
verbreitetere Name für Belemnit ist Donnerkeil. Er stammt aus der germanischen
Sagenwelt. Nach der Sage schleuderte Donar, der Donnergott mit seinen Blitzen
diese Donnerkeile zur Erde. Bis heute werden Geschiebefossilien, wie
Belemniten, Seeigel, Feuersteine (Feuersteine mit Loch – Hühnergötter) u.a. als
Amulett oder Talisman getragen. Die im norddeutschen Tiefland häufig zu
findenden Wallsteine (durch das Tertiärmeer abgerundete Feuersteine) werden
schon seit alters her aufgrund ihrer eiförmigen Gestalt als Drudeneier
(Hexeneier) bezeichnet.
Zu welchen, heute
erstaunlichen Gedanken nordische Geschiebe die Menschen im späten Mittelalter
anregten, zeigt, dass 1733 in Königsberg
C.H.RAPPOLT daran experimentiert hat, aus devonischen Kugelsandsteinen,
welcher von ihm als Rogen eines Riesenstöres gedeutet wurde, Leben zu erwecken.
Bemerkenswert ist
die Erfindung einer Steinkombine zur Beseitigung der „nach-wachsenden“ Steine
auf den Feldern Mecklenburgs und Brandenburgs. Diese Maschine arbeitet nach dem
Prinzip einer Kartoffelvollerntemaschine und wurde in Müncheberg im heutigen
ZALF (Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungs-forschung) entworfen und
in Beeskow in einer Anzahl von 20 Stück gebaut. Eingesetzt wurde sie nicht nur
in Brandenburg und Mecklenburg, sondern auch von Mittelrussland über Polen bis
Niedersachsen. Verworfen wurde dieses Projekt dann wegen zu hoher Bau- und
Betriebskosten. Diese etwas kuriose Erfindung weist darauf hin, dass die
nordischen Geschiebe auf den Feldern nicht gerade willkommen sind und beseitigt
werden müssen. Ähnlich ist es in den Tagebauen des Braun-kohlebergbaues. Auch
hier werden die Geschiebe z.T. mit großen Aufwand entfernt und auf Deponien zur
weiteren Verwendung gelagert.
Nordische Geschiebe
haben in der Wirtschaft aber neben störenden auch nicht unerhebliche nützliche
Effekte. In Ermangelung von Bruchsteinen im norddeutsch-nordpolnisch -
baltischen Raum wurden die nordischen Geschiebe schon seit Jahrhunderten als
Bausteine genutzt. Viele Straßen sowie Profan – und Sakral-bauten geben ein
beredtes Zeugnis davon ab. Die Geschiebe wurden in regelrechten
Steinbruchbetrieben, so zum Beispiel bei Althüttendorf im Choriner
Endmoränenzug oder bei Feldberg in Mecklenburg abgebaut. Der Steinbruchbetrieb
in Althüttendorf fand mit Grubenbahn und dem besonderen Beruf des Steinschlägers
von 1869 bis 1964 statt. Diese Steinschläger zerkleinerten die Geschiebe
anfangs mit der Hand und später mit Presslufthammer zu Schotter. Dieser
Schotter wurde unter anderem beim Bau der Eisenbahnlinie und der Autobahn
Berlin – Stettin (Szczecin) genutzt. Auch aus dem Muskauer Faltenbogen sind bei
Bohsdorf und Raden „Findlings-steinbrüche“
bekannt. Ein weiterer „Bergbau“ auf Geschiebe war der Kalkbergbau. An
lokalen Stellen der Endmoränen häuften sich Kalkgeschiebe derart, dass dort ein
Steinbruchbetrieb rentabel war. Dieser Kalk wurde dann in Kalköfen zu
Branntkalk weiterverarbeitet und in der heimischen Bauindustrie, der Glas-und
Papierherstellung sowie in den Gerbereien verwendet. Außerdem diente dieser
Kalk gemahlen als Dünger zur Aufbesserung der kargen Böden der Lausitz. Im
Muskauer Faltenbogen fand ein Kalkabbau bei Kalki nordwestlich Trziebel (1560
und vor 1800), Trziebel (1560), Brozek (1560 und vor 1800), Chudzowice
nordöstlich Trziebel (1748), Jedrzychowice südwestlich Trziebel (1818), Matuszowice
östlich Tuplice (vor 1800), Preschen
(1560 und vor 1800) und Zelz (um 1850) statt. Das Kalkbrennrecht also das Recht
Kalk zu Branntkalk zu verarbeiten hatte die Stadt Zary. Dort wurden z.B.
zwischen 1835 und 1848 ca. 102 m³ Kalk gebrannt.
Ein weiterer Aspekt
zur Nutzung der Nordischen Geschiebe ist die Verwendung und Verarbeitung zu
Denkmälern und als Kunstobjekte. Das wohl bekannteste ist die Granitschale im
Lustgarten vor dem Alten Museum in Berlin. Diese wurde aus dem Großen
Markgrafenstein, einem Findling aus den Rauenschen Bergen bei Fürsten-walde
gefertigt.
Es ist erstaunlich,
dass man bei einer so intensiven ökonomischen und ideellen Nutzung der
nordischen Geschiebe immer noch größere Findlinge am originalen Standort finden
kann. Schon frühzeitig wurde vor einer völligen Vernichtung dieser
Naturdenkmäler, wie Einzelfindlingen oder Findlingsansammlungen
(Block-packungen) gewarnt. Erst 1935 wurden in Deutschland durch das
Reichsnatur-schutzgesetz die Kreisverwaltungen verpflichtet, auch Findlinge und
Findlingspackungen in die Naturdenkmalslisten aufzunehmen. Derzeit gilt in
Bran-denburg das Naturschutzgesetz vom 26.05.2004, welches auch Regelungen zu
nordischenGeschieben trifft. Ähnliche Aussagen enthält das Naturschutzgesetz
von Sachsen vom 23.07.2004. In Polen werden entsprechend dem Naturschutzgesetz
vom 16.10.1991 die Findlinge standortbedingt bzw. nach petrographischen
Besonderheiten geschützt.
Teil 2 Die nordischen Geschiebe des Muskauer
Faltenbogen
Verfahrensweise und
Probleme der Kartierung der nordischen Geschiebe
Zielstellung der
aufwändigen Kartierungsarbeiten war es, die nordischen Geschiebe des Geoparkes
Muskauer Faltenbogen und unmittelbar angrenzende Gebiete zu erfassen. Zur
Erfassung wurden nachfolgende Parameter angesetzt. Die größte Kantenlänge der
Geschiebe sollte mindestens 1,0 m betragen. Eine Ausnahme bezogen auf die Größe
bilden geologisch / petrographisch interessante nordische Geschiebe. Weiterhin
sollten die Geschiebe aus dem Bereich des Muskauer Faltenbogen und nicht aus
den umgebenden Tagebauen Nochten, Welzow-Süd Jänschwalde und Cottbus-Nord
stammen. Grundlage der Kartierung waren die Meßtischblätter 1:25000 Eichenrode/
Debinka (4355), Forst/Groß-Bademeusel (4354), Döbern (4353), Weißwasser (4453),
Bad Muskau (4454) und die geologischen Karten Blatt Triebel (2476), Döbern
(2475), Weißwasser (2548) und Muskau (2549). Das Blatt Eichenrode wurde nicht
geologisch kartiert.
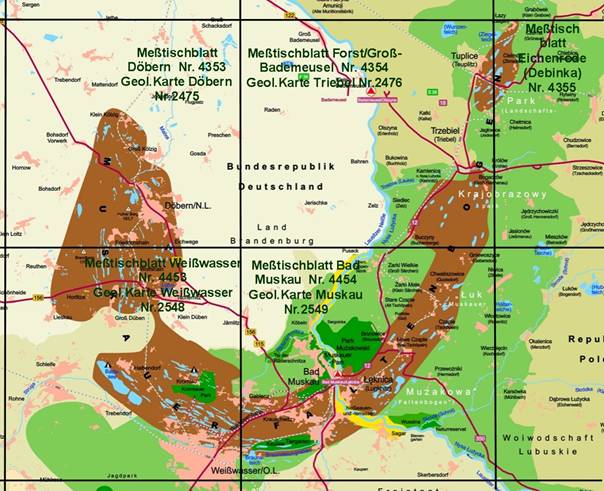
Für die
Geländearbeit war es unbedingt notwendig, die Gebiete in denen nordische
Geschiebe der zu erfassenden Größe zu erwarten waren, auszugrenzen. Dazu wurden
geschiebehöffige Gebiete, wie Grundmoränen -und Endmoränenflächen sowie
Blockfelder und bereits kartierte Geschiebe aus den geologischen Spezial-karten
auf die Meßtischblätter übernommen. Diese ergänzten Meßtischblätter bildeten
dann die Grundlage der systematischen Kartierungsarbeiten im Gelände. Die
Vermessung der im Gelände gefundenen Geschiebe erfolgte mit Bandmaß nach Länge,
Breite und Höhe. Alle Geschiebe wurden fotografiert und die Fundstelle nach
Topographie auf dem Meßtischblatt eingetragen. Die Bestimmung der Lage erfolgte
durch Abgreifen der Koordinaten vom Meßtischblatt. Die Koordinaten der im Land
Brandenburg als Geotop registrierten Geschiebe wurden vor Ort mittels GPS
ermittelt. Das Volumen der Geschiebe
ergab sichaus der Multiplikation der Länge, Breite und Höhe mit dem Faktor
0,58. Wurde ein anderer Faktor gewählt so erscheint dieser auf dem
entsprechenden Erfassungsblatt. Die Erfassung der kartierten Einzelgeschiebe
bzw. jeder Geschiebegruppe erfolgte in einem Erfassungsblatt welches folgenden Daten enhält:
·
Meßtischblatt
·
fortlaufende
Nummer des Geschiebes
·
topographische
Lage
·
Koordinaten
(Gauß-Krüger)
·
Gesteinsart
·
Größe
und Volumen
·
Besonderheiten
/ Bemerkungen ( wie Bedeckung, geol. Besonderheiten,
Geotopnummer u.a.).
Vorkommen, Größe und
Gewicht der erfassten nordischen Geschiebe
(BR – Brandenburg,
SA – Sachsen, PO – Polen) Stand Nr. 205 Gesamt:225
|
Messtischblatt 1:25000 |
Anzahl (Stck) |
schützenswerte Objekte (Stck) |
als Geotop registriert (Stck) |
||||||
|
|
BR |
SA |
PO |
BR |
SA |
PO |
BR |
SA |
PO |
|
Forst/Groß-Bademeusel (4354) |
98 |
- |
16 |
12 |
- |
7 |
10 |
- |
1 |
|
Döbern (4353) |
73 |
- |
- |
24 |
- |
- |
14 |
- |
- |
|
Weißwasser (4453) |
15 |
1 |
- |
5 |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Bad Muskau (4454) |
2 |
11 |
7 |
1 |
5 |
3 |
1 |
- |
- |
|
Eichenrode (Debinka) (4355) |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Volumen |
Größenklasse |
Anzahl |
||
|
|
|
BR |
SA |
PO |
|
< 0,5 |
1 |
82 |
4 |
6 |
|
ab 0,5 – < 1,0 |
2 |
64 |
3 |
9 |
|
ab 1,0 – < 2,0 |
3 |
34 |
- |
7 |
|
ab 2,0 – < 3,0 |
4 |
6 |
2 |
1 |
|
>3,0 |
5 |
2 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Gestein |
Größenklasse (Anzahl in Stck) |
Anteil des Gesteins an der Gesamtmenge (%) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Granit |
65 |
55 |
36 |
8 |
6 |
|
|
Gneis |
22 |
20 |
5 |
1 |
1 |
|
|
Sandstein Quarzit |
1 |
|
|
|
|
|
|
Kalkstein |
|
1 |
|
|
|
|
|
Sonstige |
4 |
|
|
|
|
|
Tabelle Dichte
|
Gesteinsbezeichnung |
Dichte in t/m³ |
|
Granit |
2,7 |
|
Diorit/Gabbro |
2,9 |
|
Quarzporphyr |
2,7 |
|
Sandstein / Quarzit |
2,5 |
|
Gneis |
2,7 |
|
Kalkstein / Marmor |
2,7 |
|
Nordische Geschiebe ≥ 1,0m³ (sichtbar) |
|||||||
|
Messtisch- blatt |
Land |
Nr. der |
Gestein |
Volumen |
Gewicht |
unter |
Geot.Nr |
|
(Nr.) |
Kartierung |
(m³) |
Schutz |
Name |
|||
|
4354 |
P |
14 |
Växjögranit |
36,3 |
101,0 |
ja |
? Teufelsstein |
|
4353 |
B |
26 |
Rönne-Granit |
6,5 |
17,6 |
ja |
2118 Gr. Finkenstein |
|
4353 |
B |
25 |
Granit |
4,1 |
11,1 |
ja |
2119 Kl. Finkenstein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4354 |
P |
53 |
Gneis |
3,7 |
10,0 |
nein |
|
|
4454 |
S |
128b |
Granit |
3,6 |
9,7 |
nein |
|
|
4454 |
S |
128a |
Granit |
3,4 |
9,2 |
nein |
|
|
4454 |
S |
130 |
Granit |
3,1 |
8,4 |
nein |
|
|
4354 |
B |
29b |
Granit |
2,7 |
7,3 |
ja |
179 |
|
4454 |
B |
131 |
Granit |
2,4 |
6,5 |
ja |
1637 |
|
4354 |
B |
150 |
Granit |
2,4 |
6,5 |
ja |
2310 |
|
4353 |
B |
64 |
Gneis |
2,4 |
6,5 |
ja |
2317 |
|
4454 |
S |
84 |
Granit |
2,2 |
6,0 |
nein |
|
|
4354 |
B |
19 |
Revsundgranit |
2,1 |
5,8 |
ja |
181 |
|
4454 |
S |
146 |
Gneis |
2,1 |
5,7 |
nein |
|
|
4454 |
P |
147 |
Gneis |
2,1 |
5,7 |
nein |
|
|
4353 |
B |
65a |
Granit |
2,1 |
5,7 |
ja |
2318 |
|
4353 |
B |
71 |
Granit |
2,1 |
5,7 |
nein |
|
|
4353 |
B |
179 |
Gneis |
1,7 |
4,59 |
ja |
2435 |
|
4453 |
B |
55 |
Granit |
2,0 |
5,4 |
nein |
|
|
4354 |
B |
1 |
Stockholmgranit |
1,9 |
5,2 |
ja |
176 |
|
4354 |
P |
51 |
Granit |
1,9 |
5,1 |
nein |
|
|
4354 |
B |
115c |
Bornholmgranit |
1,7 |
4,6 |
ja |
2311 |
|
4353 |
B |
28 |
Granit |
1,7 |
4,6 |
ja |
2440 |
|
4353 |
B |
63 |
Växjö-Granit |
1,7 |
4,6 |
ja |
2430 |
|
4353 |
B |
68 |
Granit |
1,6 |
4,3 |
nein |
|
|
4353 |
B |
174 |
Granit |
1,6 |
4,3 |
ja |
2315 |
|
4453 |
B |
56 |
Granit |
1,6 |
3,8 |
nein |
|
|
4453 |
B |
54 |
Granit |
1,5 |
4,1 |
nein |
|
|
4354 |
B |
20 |
Upplandgranit |
1,4 |
3,8 |
ja |
177 |
|
4354 |
B |
118b |
Granit |
1,4 |
3,8 |
ja |
2312 |
|
4354 |
B |
29c |
Granit |
1,4 |
3,8 |
ja |
180 |
|
4353 |
B |
76 |
Gneis |
1,57 |
4,24 |
ja |
2431 |
|
4353 |
B |
168d |
Granit |
1,2 |
3,24 |
ja |
2434 |
|
4353 |
B |
182 |
Bornholmgranit |
1,6 |
4,32 |
ja |
2437 |
|
4354 |
B |
18b |
Stockholmgranit |
1,3 |
3,5 |
nein |
|
|
4353 |
B |
175 |
Bornholmgranit |
1,0 |
2,7 |
nein |
|
|
4353 |
B |
21 |
Gneis |
1,2 |
3,51 |
ja |
2436 |
|
4354 |
P |
12 |
Stockholmgranit |
1,3 |
3,5 |
nein |
|
|
4354 |
B |
156 |
Granit |
1,3 |
3,5 |
ja |
2316 |
|
4454 |
P |
44 |
Granit |
1,2 |
3,2 |
nein |
|
|
4353 |
B |
61 |
Uppsalagranit |
1,2 |
3,2 |
ja |
2432 |
|
4353 |
B |
65 |
Granit |
1,2 |
3,2 |
ja |
2319 |
|
4353 |
B |
74 |
Granit |
1,6 |
4,32 |
ja |
2433 |
|
4353 |
B |
168a |
Granit |
1,2 |
3,4 |
nein |
|
|
4353 |
B |
78 |
Granit |
1,2 |
3,2 |
nein |
|
|
4354 |
B |
118a |
Granit(Pegmatit) |
1,2 |
3,24 |
ja |
2313 |
|
4453 |
B |
33 |
Granit |
1,1 |
3,0 |
nein |
|
|
4353 |
B |
70 |
Granit |
1,1 |
3,0 |
nein |
|
|
4353 |
B |
30 |
Granit |
1,0 |
2,7 |
nein |
|
|
4353 |
B |
58 |
Granit |
1,0 |
2,7 |
nein |
|
|
4353 |
B |
166 |
Gneis |
1,0 |
2,7 |
nein |
|
|
4354 |
P |
189 |
Karlshamngranit |
1,4 |
3,78 |
nein |
|
|
4454 |
P |
190 |
Karlshamngranit |
1,1 |
2,97 |
nein |
|
|
4353 |
B |
195 |
Gneisgranit |
1,5 |
4,05 |
ja |
2438 |
|
4353 |
B |
198 |
Granit |
1,7 |
4,59 |
ja |
2439 |
|
4354 |
P |
203 |
Granit |
1,1 |
2,97 |
nein |
|
|
4454 |
P |
202 |
Gneis |
1,2 |
3,24 |
nein |
|
|
Leitgeschiebe bzw. Geschiebe mit petrographischen /
glazigenenen Besonderheiten |
|||||
|
Nr. |
Meßtischblatt |
Nr. der Kartierung |
Bezeichnung |
Volumen (m³) |
Besonderheiten |
|
1 |
4354 |
1 |
Stockholmgranit |
1,92 |
|
|
2 |
4354 |
2c |
Bornholmgranit |
0,5 |
|
|
3 |
4354 |
2d |
Granit |
0,2 |
Windkanter |
|
4 |
4354 |
14 |
Växjögranit |
36,3 |
|
|
5 |
4354 |
15 |
Perniögranit |
0,1 |
|
|
6 |
4354 |
16 |
Bornholmgranit |
0,2 |
|
|
7 |
4354 |
17 |
Bornholmgranit |
0,5 |
|
|
8 |
4354 |
18 |
Paläoporellenkalk |
0,6 |
|
|
9 |
4354 |
18 |
Stockholmgranit |
1,34 |
|
|
10 |
4354 |
18 |
Uppsalagranit |
0,2 |
|
|
11 |
4354 |
18 |
Diorit |
0,1 |
|
|
12 |
4354 |
18 |
Dalasandstein |
0,1 |
|
|
13 |
4354 |
18 |
Smålandgranit |
0,4 |
|
|
14 |
4354 |
19 |
Revsundgranit |
2,13 |
Frostsprengung |
|
15 |
4354 |
20 |
Upplandgranit |
1,4 |
|
|
16 |
4354 |
41 |
Stockholmgranit |
0,4 |
|
|
17 |
4354 |
45 |
Granit |
0,5 |
Windkanter, Frostrisse |
|
18 |
4354 |
49 |
Bornholmgranit |
0,7 |
|
|
19 |
4354 |
50 |
Lofthammargneis |
0,5 |
|
|
20 |
4354 |
53 |
Granatgneis |
3,7 |
|
|
21 |
4354 |
85 |
Rapakivigranit |
0,4 |
|
|
22 |
4354 |
87 |
Stockholmgranit |
0,1 |
|
|
23 |
4354 |
93 |
Granit |
0,2 |
Windkanter |
|
24 |
4354 |
98 |
Granit |
0,4 |
Frostsprengung |
|
25 |
4354 |
101 |
Roter Granit |
0,2 |
|
|
26 |
4354 |
115c |
Bornholmgranit |
1,8 |
|
|
27 |
4354 |
117b |
Uppsalagranit |
0,2 |
|
|
28 |
4354 |
118a |
Pegmatitischer Granit |
1,2 |
|
|
29 |
4354 |
118b |
Granit |
1,4 |
Gletscherschrammen |
|
30 |
4354 |
140 |
Granit |
0,7 |
Frostsprengung |
|
31 |
4354 |
141 |
Revsundgranit(?) |
0,5 |
|
|
32 |
4354 |
142 |
Gneis |
0,5 |
Windkanter |
|
33 |
4354 |
143a |
Grober pegmatiti-scher Granit |
0,8 |
|
|
34 |
4354 |
154 |
Uppsalagranit |
0,4 |
|
|
35 |
4354 |
156 |
Granit |
1,3 |
Frostsprengung |
|
36 |
4353 |
26 |
Rönnegranit |
6,5 |
|
|
37 |
4353 |
30 |
Granit |
1,0 |
Wollsackverwitterung |
|
38 |
4353 |
59 |
Pegmatit mit Turmalin |
0,7 |
|
|
39 |
4353 |
61 |
Uppsalagranit |
1,2 |
|
|
40 |
4353 |
62 |
Granitporphyr |
0,4 |
|
|
41 |
4353 |
63 |
Växjögranit |
1,7 |
|
|
42 |
4353 |
77 |
Granatamphibolit |
0,4 |
|
|
43 |
4353 |
135 |
Diorit |
0,2 |
|
|
44 |
4353 |
161 |
Gneis |
0,7 |
Gletscherschrammen |
|
45 |
4353 |
163 |
Ålandrapakivi |
0,4 |
|
|
46 |
4353 |
169a |
Grober pegmatiti-scher Granit |
0,7 |
|
|
47 |
4353 |
175 |
Bornholmgranit |
1,3 |
|
|
48 |
4353 |
177 |
Bornholmgranit |
0,5 |
|
|
49 |
4353 |
182 |
Bornholmgranit |
1,4 |
|
|
50 |
4353 |
183 |
Alandrapakivi |
0,5 |
|
|
51 |
4353 |
186 |
Granit |
0,6 |
Frostsprengung |
|
52 |
4453 |
56 |
Rapakivigranit |
1,6 |
|
|
53 |
4454 |
122a |
Granit |
0,7 |
Gletscherschrammen |
|
54 |
4454 |
129b |
Siljangranit |
0,2 |
|
|
55 |
4454 |
171b |
Ålandrapakivi |
0,3 |
|
|
56 |
4554 |
82 |
Granatgneis |
8,7 |
|
|
57 |
4554 |
83 |
Smalandgranit |
9,1 |
|
|
58 |
4353 |
74 |
Bornholmgranit |
1,6 |
|
|
59 |
4353 |
75 |
Vanggranit |
0,56 |
|
|
60 |
4354 |
189 |
Karlshamngranit |
1,4 |
|
|
61 |
4454 |
190 |
Karlshamngranit |
1,1 |
|
|
62 |
4353 |
196 |
Granit |
0,15 |
Windkanter |
|
Geschiebe als kulturelle und religiöse Gedenksteine |
||||
|
Nr. |
Meßtischblatt |
Nr. der Kartierung |
Größe (m³) |
Verwendungszweck |
|
1 |
4354 |
14 |
36,3 |
Slawische Kultstätte (?) |
|
2 |
4354 |
18 |
|
Findlingsgruppe als Spielplatz für
„Doppelkopffreunde“ |
|
3 |
4354 |
51 |
1,9 |
Gedenkstein Turnverein Triebel |
|
4 |
4353 |
64 |
2,4 |
Denkmal für die Gefallenen des 1.Weltkrieges |
|
5 |
4353 |
79 |
0,3 |
Herman-Löns-Stein |
|
6 |
4554 |
82 |
8,7 |
Findlingspark Nochten |
|
7 |
4554 |
83 |
9,1 |
Findlingspark Nochten |
|
8 |
4354 |
115 |
|
Historischer Geschiebebear-beitungsplatz |
|
9 |
4453 |
122 |
|
Parkgestaltung Kromlauer Park |
|
10 |
4454 |
128 |
3,4 / 3,6 |
Parkgestaltung Muskauer Park |
|
11 |
4454 |
130 |
3,1 |
Gedenkstein an den Brücken-kopf der 1. Ukrainischen
Front am 16.04.45 |
|
12 |
4454 |
131 |
2,4 |
Gedenkstein Heimatgruppe Groß-Särchen |
|
13 |
4454 |
146 |
2,1 |
Pücklerstein am Amtshaus Muskauer Park |
|
14 |
4454 |
147 |
2,1 |
Pücklerstein im Muskauer Park |
|
15 |
4354 |
156/157 |
1,3/0,7 |
Slawische Kultstätte (?) |
|
16 |
4454 |
171a |
0,5 |
Gedenkstein Inschrift unleserlich |
|
17 |
4353 |
183 |
|
Historischer Geschiebebear-beitungsplatz |
|
18 |
4354 |
189 |
1,4 |
Kriegerdenkmal |
|
19 |
4454 |
190 |
1,1 |
Gedenkstein Johannes Paul II. |
|
20 |
4353 |
197 |
0,6 |
Stein mit Inschrift (? Bohsdorf) |
|
21 |
4354 |
201 |
0,6 |
Gedenkstein 700 Jahre Trzebiel |
|
22 |
4454 |
202 |
1,2 |
Stein mit Inschrift (Bergmannszeichen +Pustkowie) |
Sagen über Findlinge
Der
Teufelsstein bei Kemnitz
In der Mühle
an der nahegelegenen Lauba (Lanka) lebte einst eine
wunderschöne
Müllerstochter. Sie gefiel selbst dem Teufel und dieser hätte
gern das Herz
dieses schönen Mädchens erobert. Da erschien er eines Tages als zugewanderter
Müllergeselle, der vorgab, viele Länder gesehen zu haben, und er erhielt bei
dem Müller Arbeit. Er machte seine Sache auch ganz gut und hätte seinen Zweck,
das Herz der Tochter zu erobern, voll erreicht, wenn nicht die fromme Mutter
misstrauisch gewesen wäre. Sie passte scharf auf ihn auf und erkannte ihn eines
Abends als den Bösen. Daraufhin machte sie Lärm und der Teufel wurde aus dem
Haus gejagt. Als er davonging, sagte er: „Noch vor Mitternacht soll die Mühle
in Trümmern liegen!“ Er ging auf den Spitzberg bei Bahren an der Neiße, und
grub dort einen großen Granitblock aus der Erde und trug ihn in seinen Händen
nach Kemnitz (Kámenica). Er kam
aber um einige Minuten zu spät. Die Kirchturmuhr zu Triebel (Trzebiel)
schlug die Mitternachtsstunde, bevor er die Mühle erreichte. Da musste er den
Stein fallen und die Mühle in Frieden lassen. An dem Stein sieht man noch heute
die Spuren
seiner Krallen. Er zeigt auf beiden Seiten deutliche Löcher (Bohrlöcher) die
nach Sage die Spuren der Krallen des Teufels sind. Von dem Findling trägt
auch das nahegelegene Dorf Kámenica seinen Namen. Kámen heißt übersetzt Stein.
Ihlo/ Scholze,
Aus der Heimat, Forster Sagen und Lebenserinnerungen,
1994,
UK-Verlag Forst
Der Teufelsstein bei Triebel
Vierzig
Schritte von der Straße, welche von Triebel nach Kemnitz führt, an einem Bache,
welcher bei Krohle entspringt und bei Triebel vorbei in die Neiße fließt, liegt
ein großer Stein, an dessen Oberfläche sich mehrere Löcher befinden. Diese
Löcher sind Eindrücke von den Krallen des Teufels, der ihn vom Riesengebirge
durch die Lüfte hierher führte, um die an dem Bache gelegene Mühle zu zerstören.
Denn er hatte einen Groll auf den Müller, der unter seinen Handwerksgenossen
eine Ausnahme war, weil er ehrlich war. Allein als der Teufel eben angekommen,
schon ausholte, um den frommen Müller mit Weib, Kind, Knecht und Magd samt der
ganzen Mühle durch einen Wurf zu vernichten, krähte der Hahn im nahen Dorf
Kemnitz. Der Teufel wurde machtlos und musste den Stein fallen lasen, welcher
nun jedem, der an ihm vorübergeht, die gute Lehre gibt, dass man nur ehrlich
sein darf, um zu machen, dass der Teufel keine Gewalt über uns habe.
K.Haupt,
Sagenbuch der Lausitz, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1862
im Reprint
1977 Georg Olms Verlag Hildesheim/New York
Der Teufelstein bei Kemnitz
Auf einer
Wiese des Dominions Kemnitz bei Triebel liegt der Teufelstein, ein ziemlich
großer erratischer Block, der wahrscheinlich früher als Opferstein diente. Von
ihm erzählt man sich folgende Sage:
Der
Hintermüller in Triebel hatte mit dem Teufel einen Bund geschlossen, denselben
aber nicht gehalten. Der erzürnte Teufel brach im Lausitzer Gebirge unweit
Bautzen einen großen Stein vom Gebirge ab und fasste denselben mit seinen
Krallen, die sich tief hineinbohrten. Er trug ihn auf die Mühle zu, um diese zu
zerschmettern. Weil aber der Stein so schwer war, kam er nur langsam mit
demselben vorwärts; indes er war nur 200 Schritte von der Mühle entfernt, als
es in Triebel eins schlug. Zugleich krähte auch der Hahn des Müllers. Da ließ
der Teufel vor Schreck den Stein fallen, und die Mühle blieb unversehrt.
Niederlausitzer
Volkssagen vornehmlich aus dem Stadt-und Landkreis Guben, gesammelt und
zusammengestellt von Karl Gander, Berlin, Deutsche Schriftstellergenossenschaft
1894
Reprint K.Gander Niederlausitzer Volkssagen
1977 Georg Olms Verlag
Nachfolgende Sagen wurde mir durch Herrn
Grätz Groß-Kölzig freundlichst
übergeben. Beim weißen Stein handelt es sich
wahrscheinlich um den Finkenstein.
Die Jagd am weißen Stein
Der Kurfürst von Sachsen kam früher oft nach
Friedrichshain auf sein Jagd-
haus, um Wildsau, Auer- und Birkhähne zu
schießen. Da wurde er einst von
eine
wütenden Keiler angefallen. Einer seiner Hofleute warf sich dazwischen
und rettete ihm so das Leben. Das geschah am
weißen Stein zwischen
Friedrichshain und Reuthen. So oft der Fürst hier vorbeikam, stieg er ab und
betete am Stein ein Vaterunser. Diesen Stein
hatte ein Bauer einst fortge-
fahren, um ihn beim Hausbau zu verwenden.
Auf Geheiß des Gutsherrn
musste er ihn aber wieder an seinen alten
Platz schaffen. Als eine Schneise
durch den Wald gehauen wurde, traf der Weg
gerade auf diesen Stein, und er
wurde um erhalten zu bleiben, auf die rechte
Seite des Weges verbracht.
Der Findling am
Bandaluschk
Wer vor vielen Jahren um Mitternacht
in Pantoffeln an dem großen Stein,
einem Findling vorüberging, konnte auf ihm viel Gold und Silber und
andere
Schätze liegen sehen. Ein Lichtlein umtanzte sie, um die Menschen
anzulocken. Aber wehe, wenn sie der Lockung folgten! Einst näherte sich
ein
Mann dem Steine, um die Kostbarkeiten zu holen. Da stürzte sich aus dem
Bandaluschk, dem in der Nähe sich befindlichen Wasserloch, der Drache ,
der
die Schätze bewachte auf ihn und wollte ihn verschlingen. Der Mann
rannte
wie noch nie in seinem Leben und rettete sich so. Der Drache wurde
später
vertrieben, weil er sich an Pilze suchende Kinder heranmachte und sie
auffraß.
Die Einteilung der Gesteine
|
Sedimente oder Ablagerungsgesteine |
||||
|
entstanden durch
Verwitterung, Erosion oder als organische Ablagerung |
||||
|
anorganische Gesteine |
organische Gesteine |
|||
|
Lockergesteine |
|
Festgesteine |
Lockergesteine |
Festgesteine |
|
Sand/Kies |
|
Salz |
Humus |
Kalkstein |
|
|
|
Sandstein |
Torf |
Steinkohle |
|
Geschiebemergel/lehm |
Mischgesteine |
Schieferton |
Braunkohle |
Antrazit |
|
Beckenton/schluff |
Gips |
Wiesenkalk |
Raseneisenerz |
|
|
Lößlehm |
Anhydrit |
|
Kupferschiefer |
|
|
Kristalline Gesteine (entstanden durch die
Gebirgsbildung) |
|||||
|
Magmatite |
|||||
|
Tiefengesteine (Plutonite) |
Ergußgesteine(Vulkanite) Ganggesteine |
||||
|
Granite |
hell |
sauer |
Phonolithe |
sauer |
hell |
|
Syenite |
|
|
Porphyre |
|
|
|
Diorite |
|
|
Porphyrite |
|
|
|
Larvikite |
|
|
Diabase |
|
|
|
Gabbros |
dunkel |
basisch |
Basalte |
basisch |
dunkel |
|
|
|
|
Ignimbrite(Rhyolit bis Dazit) |
|
|
|
Metamorphite (Umwandlungsgesteine) |
|
|
Tonschiefer |
Wenig umgewandelt |
|
Dachschiefer |
|
|
Grauwacke |
|
|
Quarzit |
|
|
Phyllit |
|
|
Glimmerschiefer |
|
|
Marmor |
|
|
Gneis |
|
|
Eklogit |
stark umgewandelt |
Erdzeitalter (Alter in Mill.
Jahren
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Holozän |
0,01 |
|
|
Känozoikum |
Quartär |
1,8 |
|
Erdneuzeit |
|
Tertiär |
65 |
|
|
Mesozoikum |
Kreide |
142 |
|
|
|
Jura |
200 |
|
Erdmittelalter |
|
Trias |
251 |
|
|
Paläozoikum |
Perm |
296 |
|
|
|
Karbon |
358 |
|
|
|
Devon |
417 |
|
|
|
Silur |
443 |
|
|
|
Ordovizium |
495 |
|
Erdaltertum |
|
Kambrium |
545 |
|
Erdurzeit |
Proterozoikum |
|
2500 |
|
|
Archaikum |
|
4800 |
|
Eiszeitalter – Glaziale (Kaltzeiten) und Interglaziale (Warmzeiten) (Alter in Tsd. Jahren) |
||
|
Holozän |
10 |
|
|
Quartär |
110 |
Weichselglazial |
|
|
125 |
Eeminterglazial |
|
|
370 |
Saaleglazial |
|
|
450 |
Holsteininterglazial |
|
|
580 |
Elsterglazial |
|
|
1800 |
Ältere
Glaziale und Interglaziale |